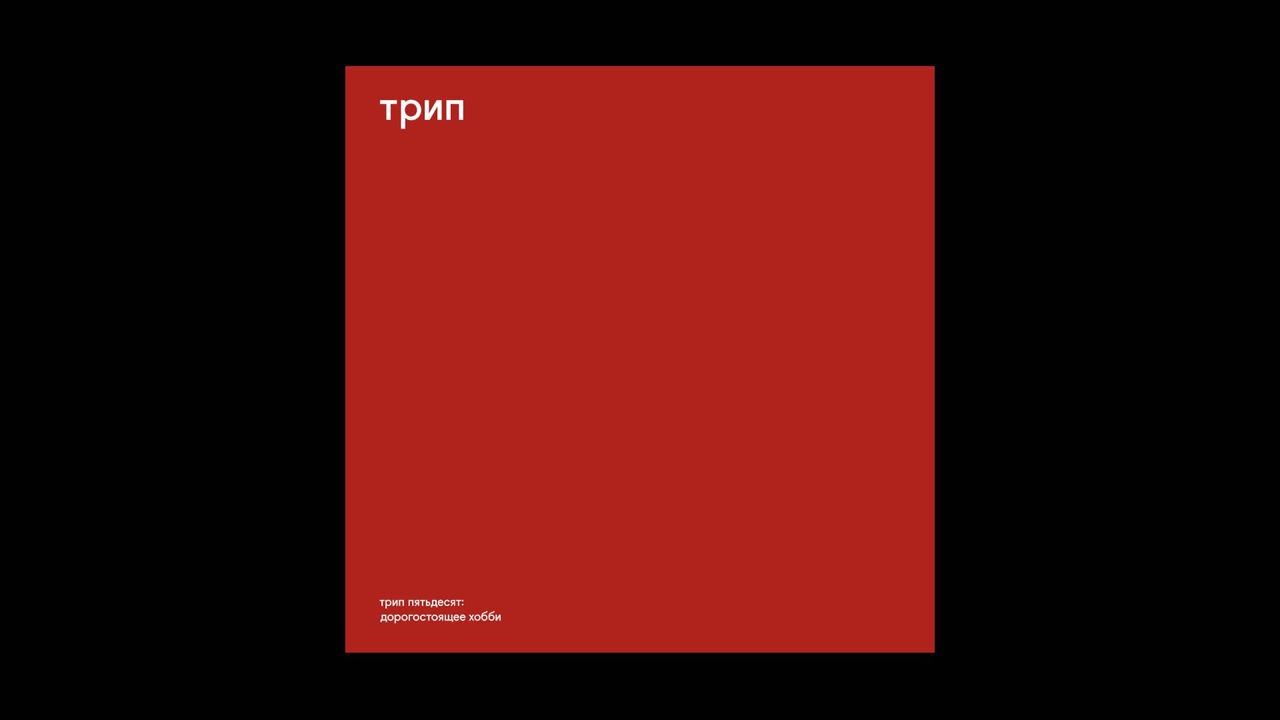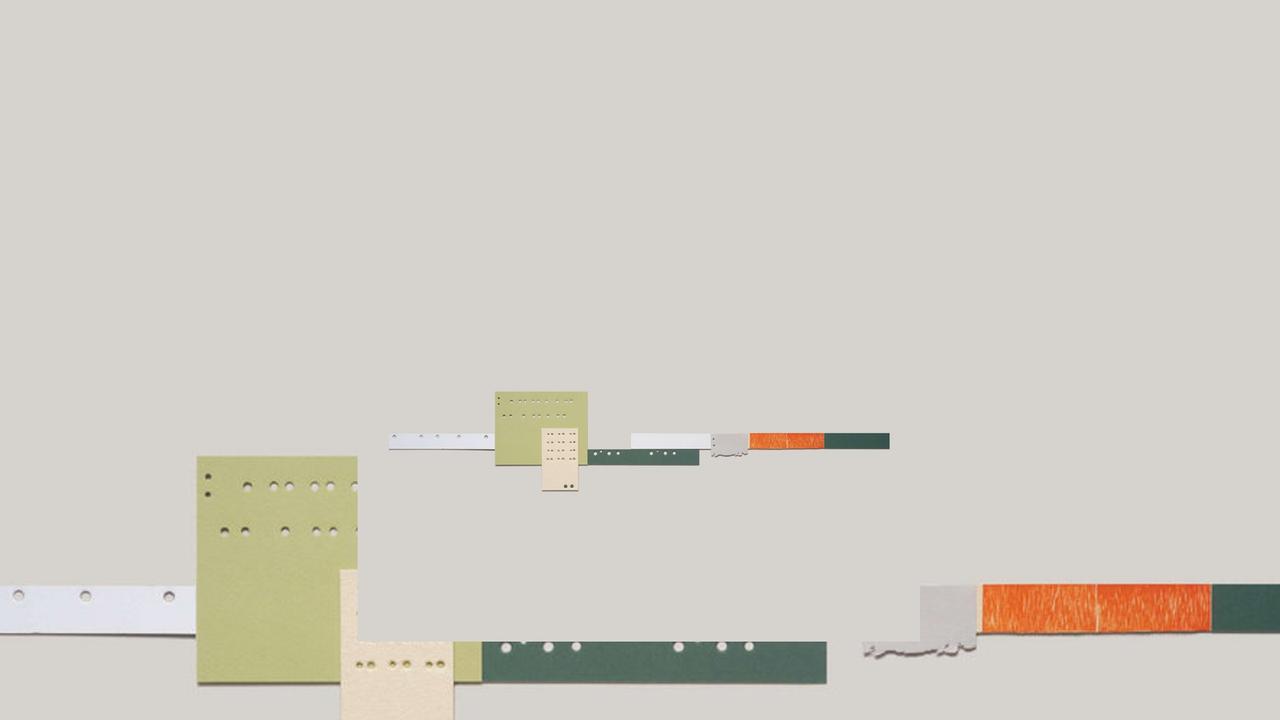Plattenkritik: Foster The People – Paradise State of Mind (Atlantic)California knows how to pop
16.8.2024 • Sounds – Text: Jan-Peter Wulf
Der Pop von Isom Innis und Mark Foster ist vielseitig. Und macht Spaß, findet Jan-Peter Wulf
Abgesehen von dem ja ziemlich großen Hit „Pumped Up Kids“ aus dem Jahr 2010 sind Foster The People, wie so viele Bands, an mir vorbeigezogen. Drei Alben hat die kalifornische Indiepop-Combo zwischenzeitlich veröffentlicht, jetzt fiel mir das vierte Album „Paradise State of Mind“ auf – Plakate an Wände kleben hilft! Es geht flott los mit „See You In The Afterlife“, einem dieser eingängigen Popsongs, für den Radiostationen dankbar sind. „Lost In Space“ ist da schon filigraner, mit wabernder Bassline und opulentem Gesang, bei „Take Me Back“, „Let Go“ und „Feed Me“ spinnen Isom Innis und Mark Foster (ohne r) den Faden so funky wie barock weiter. So was kann in Kitsch enden. Und tut es mitunter auch, aber da bin ich eben, mitunter, ein Fan von. Und verglichen mit Empire Of The Sun, kürzlich unter die Lupe genommen, ähnlicher Coverstyle by the way, sind Songstrukturen, Melodik und Arrangements facettenreicher, ornamentaler. Wenn Eklektizismus, dann so. Lustigerweise ist der Song, der wie das Album heißt, der langweiligste, am wenigsten für das Ganze repräsentative, der vorletzte Song „Chasing Low Vibrations“ bitte der Song, den die Nachbarn laut hören sollen, und „A Diamond To Be Born“ gleich hinterher. Warum ist laute Nachbarnmusik eigentlich fast immer scheiße? Anderes Thema.
Zum Schluss noch ein Tipp: Foster The People haben „Houdini“ von Dua Lipa und „Houdini“ von Eminem gemashupt, mit „Houdini“ von ihrem ersten Album. Hier das Resultat: